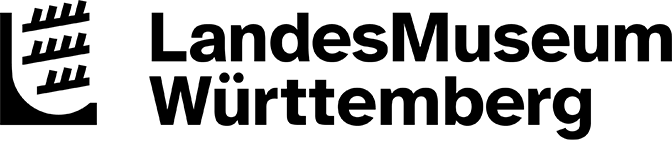Sie sieht schnell, wo der Schuh drückt. Astrid Pellengahr berät seit vielen Jahren Museen. Dass im Landesmuseum Württemberg die Strukturen stimmen, hat die neue Direktorin sofort erkannt. Trotzdem hat die zupackende Chefin die Ärmel schon hochgekrempelt, um in den verschiedenen Ausstellungshäusern noch stärker den Perspektivwechsel zu üben. Denn damit sich verschiedenste Besuchergruppen in einem Museum wohlfühlen, müsse man deren Sicht einnehmen, meint Astrid Pellengahr. Dass sie nur wenige Tage nach dem Interview zunächst an ganz anderer Stelle schnell und überlegt würde handeln müssen, ahnte sie zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht.
Museumsarbeit in Zeiten von Corona
Am 13. März mussten die Stuttgarter Museen wegen der Corona-Pandemie schließen, und eine Zeit anderen Arbeitens begann. Bei der Neuorganisation des Museumslebens waren der Direktorin Astrid Pellengahr »vor allem drei Dinge sehr wichtig: die Gesundheit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unseres Publikums sowie die Sicherheit der Objekte in unseren Sammlungen. Dafür habe ich Sorge getragen und Vorkehrungen im Team getroffen. Ein Großteil des Teams arbeitet von zu Hause, um das Ansteckungsrisiko zu verringern beziehungsweise auszuschließen. Natürlich müssen aus Sicherheitsgründen verschiedene Bereiche im Museum weiterhin regelmäßig besetzt sein. Hierzu zählen unter anderem der Objektschutz oder die präventive Konservierung.« (Stand April 2020)

Frau Pellengahr, Ihre Vorgängerin hat viel auf den Weg gebracht. Können Sie erst einmal die Füße hochlegen?
Nein, überhaupt nicht. Frau Ewigleben hat tatsächlich in diesem Haus unglaublich viele Strukturen gelegt, die es mir jetzt ermöglichen, gut zu starten. Das trifft man nicht in jedem Haus an. Aber Strukturen sind nicht auf ewig, man muss sie immer durchdenken und verändern, weil neue Aufgaben dazukommen.
Sie haben als Leiterin der Landesstelle der nichtstaatlichen Museen in Bayern viele Museen beraten. Hätte man Sie ans Landesmuseum Württemberg gerufen, welche Tipps hätten Sie gegeben? Wo drückt der Schuh?
Da ist die große Aufgabe »Depot«, die in jedem Museum ansteht. Aber das Thema ist bereits in der Pipeline – und wir werden sicher einige Jahre daran arbeiten. Es hängt viel dran, wenn man mit dem Großteil von etwa einer Million Objekten umziehen will. Wenn wir hoffentlich in 10 Jahren in ein neues Depot umgezogen sein werden, dann waren wir schnell.
Es wird gern vom Museum als Lernort gesprochen. Was soll man im Landesmuseum Württemberg denn lernen?
Sie sollen gar nicht lernen! Ich bin nicht glücklich mit dem Begriff, denn mit Lernen verbinden wir alle Schule. Menschen gehen in ein Museum, weil sie ihre Freizeit verbringen, Neues erfahren oder mit Freunden oder der Familie etwas unternehmen möchten. Dabei findet nebenbei informelle Wissensvermittlung statt, die immer damit zu tun hat, welche Themen mich interessieren. Was ich mir wünsche, ist ein Ort, der zur Reflexion anregt. Wir müssen qualifizierte Angebote machen – die sich die Besucherinnen und Besucher dann auf ihre Weise aneignen.
 Sie wollen breitere Besuchergruppen erreichen. Aber gehört es nicht eigentlich zum traditionellen Verständnis von Museen, sich nur an eine kleine gebildete Gruppe zu richten?
Sie wollen breitere Besuchergruppen erreichen. Aber gehört es nicht eigentlich zum traditionellen Verständnis von Museen, sich nur an eine kleine gebildete Gruppe zu richten?
Sie haben Recht, es ist in der Struktur vorgegeben – erst einmal. Aber es ist ein Unterschied zwischen der Verheißung »Kultur für alle« oder ob ich sage: »Ich möchte möglichst breite Bevölkerungskreise ansprechen«. Wir müssen stärker reflektieren, wen wir erreichen wollen. Zum Beispiel haben Museen oft Angebote für Hörgeschädigte, die nicht gut angenommen werden. Deshalb muss man über die Gehörlosenkultur nachdenken. Was wünschen sich Gehörlose? An meiner früheren Wirkungsstätte habe ich ein Projekt angestoßen, bei dem Gehörlose zu Kunst- und Kulturvermittlern ausgebildet wurden. Das war für mich eine große Erfahrung. Man muss mit Gehörlosen in Kontakt treten, ihre Bedürfnisse und Wünsche erfragen, um Angebote auszuarbeiten, für die wirklich eine Nachfrage besteht. Deshalb spreche ich gern vom Perspektivwechsel.
Museumsbesucherinnen und Besucher müssen ein Stück weit leidensfähig sein. Glauben Sie, man kann Ausstellungen so gestalten, dass sie nicht anstrengend sind?
Ja, das glaube ich schon. Man muss zum Beispiel nicht drei Mondsichelmadonnen ausstellen, wenn der Erkenntniswert dadurch nicht außerordentlich gesteigert wird, sondern kann sich auf eine beschränken. Aber es geht auch um Besucherführung, weshalb wir ein Schild aufstellen werden »Genießen Sie die zweite Hälfte der Ausstellung«, damit unser Publikum überlegen kann, ob es eine Pause einlegen möchte. Auch der neue Multimediaguide wird klarmachen, was im Haus wo zu finden ist, wie man auf dem schnellsten Weg dort hinkommt oder was unsere Highlights sind.

Sie haben Völkerkunde und Soziologie studiert. Verstehen Sie sich eher als Wissenschaftlerin oder als Museumsmanagerin?
Ich habe schon während meiner frühen Berufsjahre gelernt, dass wir das wissenschaftliche Fundament brauchen, um seriös handeln zu können. In meiner Arbeit macht es aber nur noch 3 Prozent aus. Museum hat sehr viel mit Management zu tun. Wenn man das nicht gern macht, ist man hier falsch. Ich bin Managerin, aber das kann ich nur gut, weil ich ein wissenschaftliches Fundament habe, sonst würde ich meine Kolleginnen und Kollegen aus der Sammlung nicht verstehen.
In Kunstmuseen ist es üblich, dass neue Direktoren die Sammlung ersteinmal umhängen.
Da würden sich die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus bedanken. (lacht)

Was halten Sie von digitalen Angeboten in Ausstellungen?
Medieneinsatz darf nicht l’art pour l’art sein und um seiner selbst willen entstehen, sondern macht dann Sinn, wenn wir mit den herkömmlichen Techniken an eine Grenze kommen. Mit Hilfe von Medien kann man den Objekten näherkommen. In der Uhrensammlung kann ich mit einem Film in ein Uhrwerk hineinschauen und zeigen, wie ein Uhrenautomat funktioniert. Das sind tolle Perspektiven, die der Medieneinsatz erst ermöglicht.
Kann man in einem so großen Haus wie dem Alten Schloss überhaupt innovative Konzepte realisieren?
Ich möchte experimentieren. Im Zuge der Sanierung der Dürnitz wird auch der angrenzende Ständesaal als Ausstellungsfläche ertüchtigt. Hier können wir dann Ausstellungen und kleine Formate realisieren, bei denen wir schneller reagieren und vielleicht auch aktuellere gesellschaftliche Fragen aufgreifen können. Ein Museum ist eine komplexe Einrichtung, die nicht so schnell auf Themen reagieren kann wie Twitter. Wir müssen den Spagat schaffen, in einer Einrichtung, die durch ihre Strukturen ein Stück weit zu Langsamkeit verdammt ist, zu schauen, wo wir schnell sein können.
Gibt es Vorbilder, kulturhistorische Sammlungen lebendiger zu vermitteln, oder muss man alles selbst erfinden?
Nahezu nichts gab es nicht schon in der Museumswelt. Interventionen sind zum Beispiel schon in den unterschiedlichsten Bereichen ausprobiert worden. Wenn das Linden-Museum eine Ausstellung zum Kolonialismus macht, können wir auch durch unsere Sammlung gehen und überlegen, ob wir jemanden ins Haus holen, der da Expertise hat – und dann vielleicht eine Intervention machen. Denn die große Frage ist immer wieder, wie man mit der Sammlung einen Gegenwartsbezug herstellen kann.
Bedeutet externe Beratung nicht Machtverlust?
Viele Kuratorinnen und Kuratoren halten ihre Expertise für ihre Kernkompetenz und wollen ungern von der Deutungshoheit abrücken. Das sind Begriffe, die Bedenken bei mir auslösen. Ich will nicht, dass Museum Macht ausübt, weil das keine Reflexion ermöglicht. Wir haben ein hoch kompetentes Team, dessen Aufgabe es ist,Dinge zu deuten. Aber unsere Interpretation ist nie die einzige und alleingültige. Es gibt andere Perspektiven. Lange war zum Beispiel Migration kein Thema, dabei haben wir Objekte, die viel dazu erzählen könnten. Die Geschichten stecken in den Objekten, aber oft wurden nicht die entsprechenden Fragen gestellt.
Sind Sie eine Kämpfernatur? Wie reagieren Sie auf Gegenwind? Wütend? Trotzig? Traurig?
 Damit kommt man nicht weiter. Ich würde mich als diplomatische Kämpferin bezeichnen. Um Ziele zu erreichen, muss man Überzeugungsarbeit leisten, Menschen ins Boot holen, auch den Träger mit ins Boot holen. Aber man kann nicht alles durchsetzen. Das muss man sportlich nehmen. Mich schreckt es nicht, wenn vor mir ein großer Berg steht, weil ich weiß, ich habe Überzeugungskraft und einen langen Atem.
Damit kommt man nicht weiter. Ich würde mich als diplomatische Kämpferin bezeichnen. Um Ziele zu erreichen, muss man Überzeugungsarbeit leisten, Menschen ins Boot holen, auch den Träger mit ins Boot holen. Aber man kann nicht alles durchsetzen. Das muss man sportlich nehmen. Mich schreckt es nicht, wenn vor mir ein großer Berg steht, weil ich weiß, ich habe Überzeugungskraft und einen langen Atem.
Wie schätzen Sie Ihren Arbeitsstil ein?
Ich bin eine Perfektionistin. Wenn man das nicht ist, ist man falsch im Museum. Ich versuche, die Dinge strukturiert vorzudenken. Beim Thema Sicherheit und Objektschutz kann ich nicht sagen, dass 90 Prozent reichen. Da muss alles daran gesetzt werden, 100 Prozent zu erreichen. Aber ich habe auch gelernt, dass man nicht an jeder Stelle die absolute Perfektion braucht. Ich sehe es auch als meine Aufgabe, genügend Raum für Kreativität zu schaffen. Ich bin gerne eine Querdenkerin, ich bin so eine Kaffeeküchen-Kreative, deshalb möchte ich mehr Orte schaffen, wo wir uns begegnen – auch außerhalb einer Besprechungssituation.
Sie sind an der Nordsee geboren, im Sauerland und im Allgäu aufgewachsen und haben jetzt lange in München gelebt. Sind Sie in Stuttgart schon angekommen?
Ich wohne hier seit Dezember, aber es wäre vermessen, zu sagen, dass ich schon ein Gefühl für Stuttgart und Württemberg habe. Doch ich komme mit guten Grundlagen und verstehe den Dialekt. Bereits jetzt habe ich mehrere Reiseführer zu Hause, um zu schauen, was mein Mann und ich uns erwandern wollen. Ich freue mich auf diese Stadt und das Land!
Ursprünglich erschienen in aufgeSCHLOSSen 2020/1